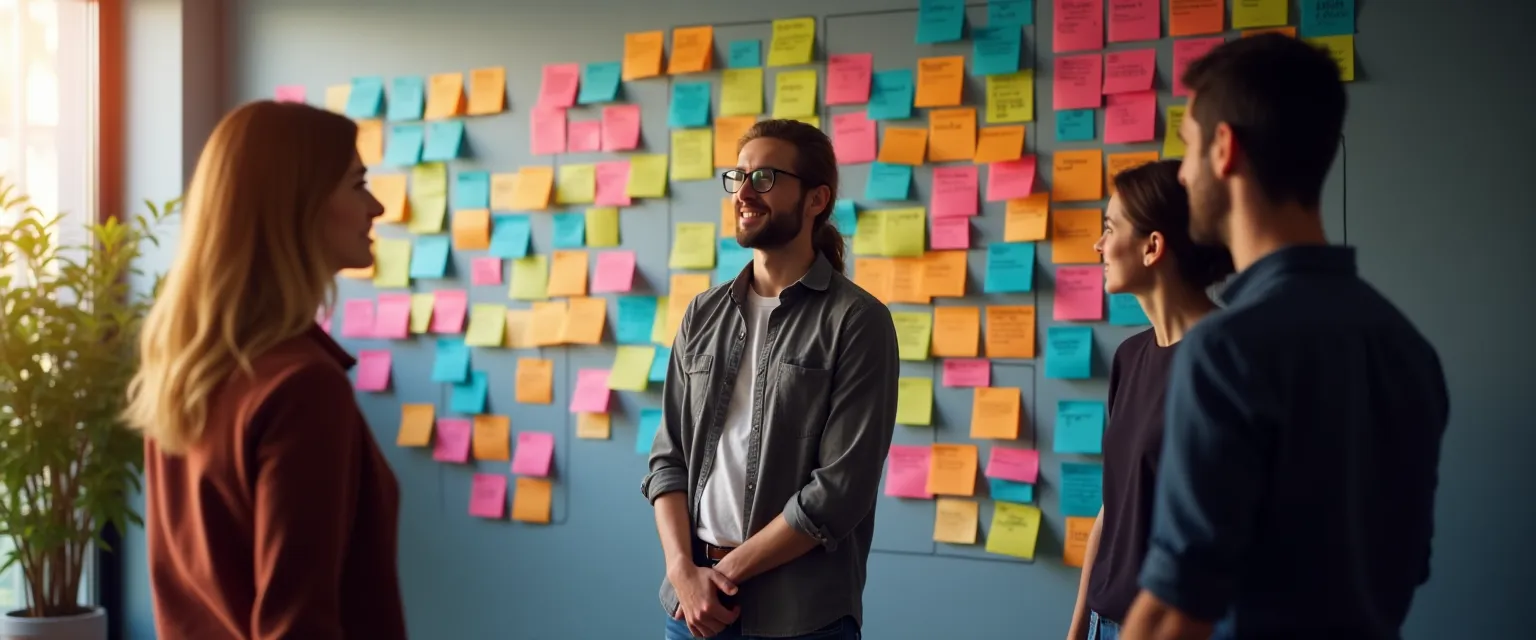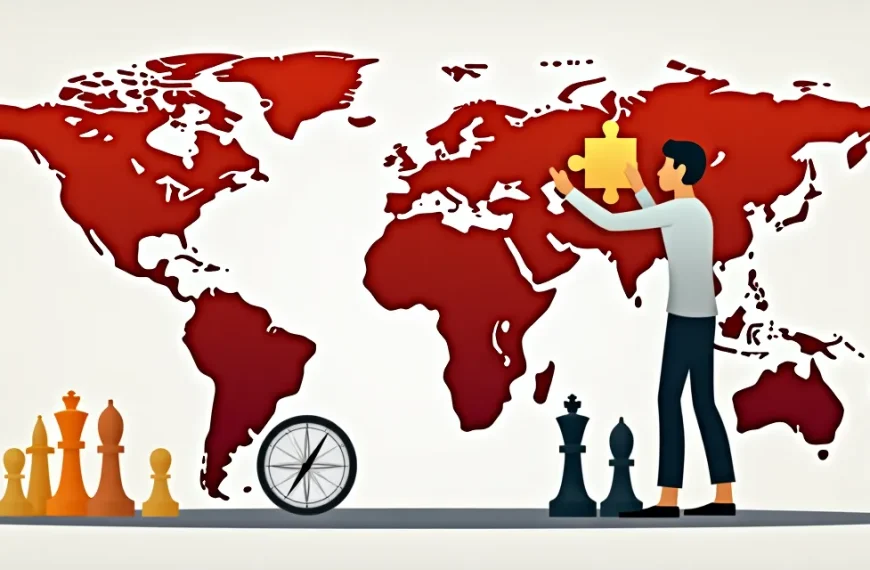Strategische Klarheit statt blinde Experimente
Wenn Innovationsbudgets schrumpfen und Wettbewerber plötzlich mit völlig neuen Technologien auftrumpfen, wird klar: Nur Bewährtes zu pflegen reicht nicht. Aber alles auf radikale Sprünge zu setzen, ist auch riskant. Viele Firmen stecken genau in diesem Dilemma. Sie fragen sich, ob sie lieber das Bestehende konsequent verbessern oder das Neue von Grund auf denken sollen.
Die Antwort liegt selten in einem Entweder-oder. Erfolgreiche Unternehmen führen beide Ansätze bewusst zusammen: Sie optimieren dort, wo es Wirkung verspricht, und experimentieren dort, wo neue Chancen entstehen. Wer diese Balance steuern kann, verwandelt Innovation von einer reaktiven Pflicht in ein aktives Steuerungsinstrument – und legt damit die Basis für nachhaltiges Wachstum.
Zwei Innovationsformen – zwei Logiken
Inkrementelle Innovation verbessert bestehende Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle Schritt für Schritt. Sie nutzt vorhandene Stärken, senkt Kosten oder steigert Qualität. Unternehmen profitieren relativ schnell von den Ergebnissen, da die Risiken überschaubar bleiben und die Umsetzung meist innerhalb bestehender Strukturen erfolgt.
Disruptive Innovation folgt hingegen einer anderen Logik. Sie stellt grundsätzliche Annahmen infrage – über Kunden, Märkte oder Geschäftsmodelle. Sie bringt neue Technologien oder Lösungen hervor, die bestehende Angebote verdrängen können. Diese Form der Innovation ist riskanter, braucht mehr Zeit, kann aber ganz neue Wachstumsperspektiven eröffnen.
Inkrementelle Innovation wirkt also schnell, verlässlich und nah am Kerngeschäft. Sie sichert bestehende Marktanteile und verbessert die operative Performance. Disruptive Innovation zielt auf neue Märkte oder völlig andere Geschäftsmodelle. Sie braucht Freiraum, Durchhaltevermögen – und oft auch den Mut, mit Unsicherheit zu arbeiten.
Die strategische Ausgangslage entscheidet
Beide Ansätze haben ihren Platz – aber nicht unbedingt zur selben Zeit, am selben Ort und unter denselben Bedingungen. Denn ob inkrementelle oder disruptive Innovation sinnvoll ist, hängt stark vom Umfeld ab. In stabilen Märkten mit treuen Kunden lassen sich durch schrittweise Verbesserungen oft solide Ergebnisse erzielen. Wenn sich Märkte jedoch schnell verändern oder technologische Umbrüche bevorstehen, greift ein rein inkrementeller Ansatz schnell zu kurz.
Auch die internen Ressourcen sind entscheidend. Disruptive Projekte erfordern langfristige Budgets, Geduld und die Bereitschaft, Fehler als Teil des Lernprozesses zu akzeptieren. Inkrementelle Innovation kommt mit weniger Mitteln aus und zahlt schneller auf Geschäftsergebnisse ein. Entscheidend ist, realistisch einzuschätzen, was das Unternehmen leisten kann – kulturell, finanziell und strukturell.
Wann welcher Ansatz sinnvoll ist
In etablierten Märkten mit hoher Kundentreue sichern inkrementelle Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit. Sie helfen, die Marktposition zu halten und kontinuierlich steigende Kundenerwartungen zu erfüllen.
Disruptive Innovation ist hingegen gefragt, wenn Unternehmen sich aus stagnierenden Märkten lösen, neue Geschäftsfelder erschließen oder sich auf absehbare Marktveränderungen vorbereiten wollen – etwa technologische Durchbrüche oder regulatorische Umbrüche. Hier braucht es die Bereitschaft, bestehende Routinen zu verlassen und ohne Garantie auf Erfolg zu investieren.
Ambidextrie als strategischer Lösungsweg
In vielen Fällen ist eine Kombination beider Ansätze sinnvoll: Das parallele Verfolgen beider Innovationsformen, auch “Ambidextrie” genannt – allerdings klar getrennt organisiert. Das Tagesgeschäft folgt Effizienzzielen und Prozesslogik. Zukunftsprojekte dagegen arbeiten unabhängig, mit eigenen Regeln und Freiräumen. Diese strukturelle Trennung ist notwendig, um Zielkonflikte zu vermeiden.
Während inkrementelle Innovation nach klassischen Projektkennzahlen wie ROI oder Time-to-Market gesteuert wird, gelten für disruptive Vorhaben andere Maßstäbe. Hier stehen Lernziele, Hypothesentests und Pilotergebnisse im Vordergrund. Teams müssen scheitern dürfen – und daraus schnell lernen. Ein zu früher Abbruch aus Rentabilitätsgründen verhindert oft das Entstehen echter Innovationen.
Ein durchdachter Portfolio-Ansatz hilft, Ressourcen sinnvoll zu verteilen: Meistens fließt der Großteil in inkrementelle Vorhaben, aber ein gezielter Teil landet in disruptiven Projekten mit langfristigem Potenzial. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wandel.
Organisation und Führung differenziert aufstellen
Für inkrementelle Innovation braucht es klar definierte Prozesse, schnelle Entscheidungswege und funktionale Zuständigkeiten. Verbesserungen können so systematisch erfasst, bewertet und umgesetzt werden.
Disruptive Innovation erfordert dagegen eher autonome Teams mit unternehmerischer Haltung. Sie müssen frei von bestehenden Strukturen agieren können – direkt angebunden an die Unternehmensleitung. Diese Einheiten brauchen Zugang zu neuen Technologien, Netzwerken und Märkten, ohne durch interne Vorgaben ausgebremst zu werden.
Auch die Führungsrollen unterscheiden sich deutlich: In der inkrementellen Welt zählen Zielklarheit, Prozesssicherheit und Effizienz. In der disruptiven Welt geht es um Vertrauen, Freiraum und die aktive Verteidigung des Neuen gegen interne Widerstände.
Von der Strategie zur Umsetzung
Nach der strategischen “ambidextrischen” Entscheidung beginnt die konkrete Umsetzung. Eine klare Innovationsstrategie definiert, welchen Beitrag beide Ansätze zum Unternehmenserfolg leisten sollen – und warum bestimmte Ressourcen auch ohne kurzfristige Rendite in Zukunftsprojekte fließen. Diese Transparenz schafft Orientierung und reduziert Zielkonflikte.
Zudem braucht es unterschiedliche Erfolgskriterien. Inkrementelle Projekte lassen sich klassisch messen: etwa durch Effizienzgewinne, Time-to-Market oder Kundenzufriedenheit. Bei disruptiven Initiativen geht es um Lernfortschritte, Hypothesenvalidierung und den Aufbau neuer Kompetenzen.
Gleichzeitig ist der Austausch zwischen beiden Welten wichtig. Inkrementelle Teams bringen Marktkenntnis und Kundenverständnis ein. Disruptive Teams liefern technologische Impulse und neue Perspektiven. Regelmäßige Dialogformate schaffen gegenseitiges Verständnis und vermeiden Stillstand.
Innovationsfähigkeit als Führungsleistung
Die richtige Innovationsstrategie entscheidet über langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Inkrementelle Innovation kann die aktuelle Marktposition sichern und Ressourcen für zukünftige Investitionen generieren. Disruptive Innovation hingegen soll wirklich neue Wachstumsfelder erschließen und vor strategischer Erosion schützen. Wer beide Ansätze beherrscht und situativ richtig einsetzt, kann auch durch volatile Märkte erfolgreich navigieren.
Die Herausforderung besteht weniger darin, sich zwischen den beiden Möglichkeiten zu entscheiden, sondern sie gezielt miteinander zu kombinieren. Beginnen Sie mit einer ehrlichen Bewertung Ihrer strategischen Ausgangslage und schaffen Sie die organisatorischen Voraussetzungen für beide Innovationsformen. So verwandeln Sie Innovation von einer reaktiven Notwendigkeit in einen proaktiven Wettbewerbsvorteil.